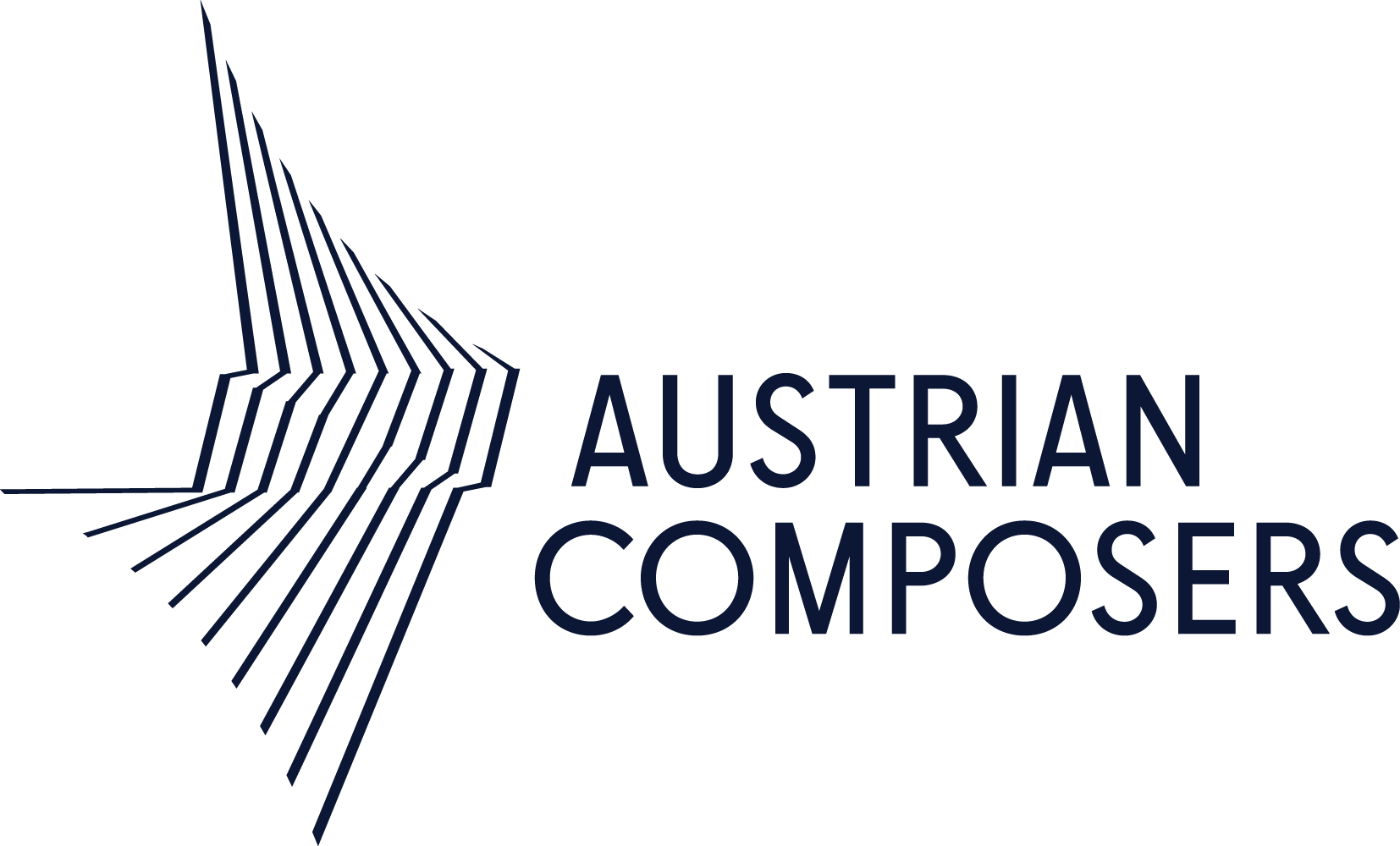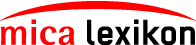"Schon 1974 erhielt Wagendristel ersten Flötenunterricht, studierte von 1980 bis 1990 an der Musikhochschule Wien und erhielt Unterricht in Flöte bei Werner Tripp, Komposition besuchte er bei Friedrich Neumann, Heinrich Gattermeyer und Erich Urbanner. 1988 folgten der Besuch der Darmstädter Ferienkurse für neue Musik und ein Meisterkurs von Aurèle Nicolet. 1988-1992 war er Mitglied der Improvisationsgruppe „Things of NowNow“, bevor er dann 2002 mit Roland Freisitzer und Thomas Heinisch das ensemble reconsil gründete, das schon seit nunmehr 2007 auch einen wichtigen Zyklus im Arnold Schönberg Center bestreitet.
„Things of Nowow“ ist für ihn eine wichtige Station gewesen, bei der wir in unserem Gespräch eine Zeit lang verweilten. Denn mit seinem damaligem Kompositionsstudium-Kollegen Lukas Ligeti, der sich als Schlagzeuger betätigte und bereits damals versuchte mit elektronischem Schlagzeug und elektronischer Marimba polymetrisch zu arbeiten, bildete Alexander Wagendristel gemeinsam mit Friedrich Neubarth (Blockflöten, „Tröten“) und dem Kontrabassisten Christian Minkowitsch dieses Improvisationsensemble."
Heinz Rögl (2010): Porträt: Alexander Wagendristel. In mica-Musikmagazin.
Stilbeschreibung
"Alexander Wagendristels Schaffen lässt sich – wie er im Großen und Ganzen bestätigte – grob in bisher 4 Stilphasen einteilen:
Die Frühphase (erste Versuche machte er aber schon mit 4 Jahren) 1980-1987 während seines Studium wäre stilistisch eher „konservativ-epigonal“ gewesen, 1988-1994 erfolgte durch die Arbeit mit der Gruppe Things of NowNow die Ausbildung eines durch György Ligeti, Igor Strawinsky und die Minimalisten angeregten, bereits sehr persönlichen Stils, der von Polymetrik und “verbogener” Tonalität gekennzeichnet ist. Die mit 1994-2002 umrissene Werkphase brachte eine weitere Annäherung an die Klangsprache der europäischen Avantgarde, wenngleich der Ansatz mit Polymetrik und dominierender Rhythmik erhalten blieb. Hinzu kommt die Ableitung der Tonhöhen aus der Obertonreihe – Proportionen spielen auch im rhythmischen Bereich in dieser Phase eine bedeutende Rolle. Verstärkt wird Mikrotonalität eingesetzt.
Von 2003 bis heute gibt es auf Basis der vorhergegangenen Erfahrungen eine Ausbildung des vom Komponisten selbst als “seine eigene Sprache” empfundenen Stils, dessen Hauptelemente Heterophonie, Hoketus-Techniken, eher locker gehandhabte Mikropolyphonie, Wechsel- und Polymetren bilden, dessen Tonmaterial aus der Obertonreihe abgeleitet wird – nun durchaus mit verstärkt tonal gefärbten Klängen, „die aber nie in ein Retrogefühl abdriften.“ Deutlich merkbar sind auch Einflüsse aus Rock und Jazz sowie außereuropäischer Ethnomusik.
In den achtziger Jahren schrieb Wagendristel vor allem kammermusikalische Werke, bereits 1986 wurde im Österreichischen Rundfunk seine 1.Symphonie („Torso“) uraufgeführt, die er 1996 noch einmal revidierte und dann auch gleich noch eine Symphonie Nr.2. für 4 Percussionisten und Kammerorchester komponierte.
1991-95 schrieb er eine bemerkenswerte Oper in zwei Akten („Der Narr“ nach E.A. Poe), die von der Neuen Oper Austria im Schlosstheater Schönbrunn mit großem Erfolg zur Aufführung gelangte. Auch eine Kurzoper über Adam und Eva („The Very First Soap Opera“, 1997) hat er verfasst, die in Berlin-Neukölln aufgeführt wurde und einen Preis des Berliner Opernwettbewerbs erhielt. Bereits 1994 führte NetzZeit (Nora & Michael Scheidl) das Singspiel „Die Liebe zu den 3 Orangen“ für 9 Sänger, 2 Schauspieler und Violine, Trompete, Piano und Tape auf.
Als Flötist im Orchester der Vereinigten Bühnen, auch bei Musical-Produktionen, beschäftigte er sich seit langem mit der Musical-Komposition. Sein Musical über den Gründer des Roten Kreuzes Henry Dunant – „soll heuer im Sommer fertig sein“. Neben dem Komponieren verlegte er sich auch immer wieder auf das Arrangieren, etwa für Ensembles wie die Vienna Horns oder das Blechbläserquintett Art of Brass, im Ensemble reconsil entstanden aber etwa auch respektable Schönberg-Bearbeitungen für Kammerensemble. Seine exorbitanten handwerklichen und satztechnischen Fähigkeiten kommen ihm dabei zugute zwischen unterschiedlichsten musikalischen Sprachen zu wechseln."
Heinz Rögl (2010): Porträt: Alexander Wagendristel. In mica-Musikmagazin.
"Hauptträger meines musikalischen Denkens ist der Rhythmus, der entweder mathematisch berechnet oder als freie Wechselmetrik oder Polymetrik gestaltet sein kann. Meist entsteht eine Kombination aus allen drei Elementen, wobei Permutationen, Interlockingtechnik und (strawinskysche) Fortspinnungs- und Zellenarbeit stets für größtmögliche Flexibilität sorgen. Vorausberechenbarkeit soll möglichst ausgeschaltet sein oder den Hörer auf falsche Fährten locken. Eine ähnliche Doppelbödigkeit kennzeichnet auch mein melodisch-harmonisches Denken - hier werden oft künstliche Tonalitäten (durch selbsterfundene Modi) oder gleichzeitig einander zum Zwölfton-Total oder einer anderen Summenstruktur ergänzende Materialien verwendet.
Die harmonischen Möglichkeiten reichen vom Dreiklang, der aber in einem traditionelle Tonalität verhindernden Zusammenhang verwendet wird, bis zu Clustern und geräuschhaften Klangballungen. In meinen neuesten Werken wird auch verstärkt Mikrotonalität benützt. Alles ist auf Lebendigkeit hin konzipiert und oft auch mit etwas Humor verbunden - ich würde bei mir von surrealistischer Musik sprechen, auch da mich Dada und Surrealismus in Kunst und Literatur stark beeinflußt haben. Musikalische Einflüsse kann man bei mir von Strawinsky, Messiaen, mittelalterlicher Musik, außereuropäischer Folklore, Jazz und Rock bemerken, wobei diese nur sublimiert in meine Musik gelangen und voll in meinen Stil integriert werden.
In neueren Werken bildet die Grundlage ein Proportionssystem, das sich sowohl auf die zeitliche Ausdehnung als auch auf die Frequenzen der verwendeten Töne (auf Basis der Obertonreihe) bezieht. Ab 1994 treten wieder verstärkt klangliche Einflüsse und Techniken der landläufig als Avantgarde bezeichneten Musik auf (nachdem schon 1988/1989 ein starker Einfluß von György Ligeti festzustellen war), das Musikdenken der Nachkriegsavantgarde hat auch dazwischen meine Denkweise beherrscht (auch wenn es manchmal nicht hörbar ist); beim besten Willen nicht übernehmen konnte und werde ich den selbstverliebten Pseudotiefsinn, das "eitle Nachlauschen der Generalpausen" (Zitat Franz Koglmann), die intellektuelle Hochstapelei der Avantgardisten (?) der dritten Generation, die die Szene in Wien beherrschen, wo wir offensichtlich weiterhin dem Lauf der Musikgeschichte 30 Jahre nachhinken. Musik kann auch anders sein (und hat meiner Meinung nach auch anders zu sein!) als Selbstbespiegelung und Klage über die ach so schlechte Welt.
Meine Musik ist komplex, bemüht sich aber um Verbindlichkeit und Plastik der Aussage."
Alexander Wagendristel (1994/1997), zitiert nach: Günther, Bernhard (1997) (Hg.): Lexikon zeitgenössischer Musik aus Österreich: Komponisten und Komponistinnen des 20. Jahrhunderts. Wien: music information center austria, S. 1112.
Auszeichnungen & Stipendien
1985 Kompositionswettbewerb "Neue Hausmusik": 1. Preis (Zwei Stücke für Klavier vierhändig)
1985 ORF - Österreichischer Rundfunk Preisträger beim Kompositionswettbewerb "Hast du Töne?"
1992 Bundeskanzleramt, Sektion für Kunst und Kultur: Staatsstipendium für Komposition
1997 Neuköllner Oper: 3. Preis beim Kurzopernwettbewerb (The very first Soap Opera)
2001 Kompositionswettbewerb - Internationale Gesellschaft für Neue Musik - IGNM Österreich 1. Preis
2015 Bundeskanzleramt, Sektion für Kunst und Kultur: Kompositionsförderung
2016 Bundeskanzleramt, Sektion für Kunst und Kultur: Kompositionsförderung
2018 Bundeskanzleramt, Sektion für Kunst und Kultur: Kompositionsförderung
2023 Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport: Kompositionsstipendium
TYPHON - für Klavier und Orchester
Stadt Wien Förderungspreis
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Förderungspreis
Theodor Körner Fonds Förderungspreis
Bundeskanzleramt Österreich Kunst und Kultur Förderungspreis
Ausbildung
1974–1980 Franz-Schmidt-Musikschule, Perchtoldsdorf: Flöte (Robert Wolf)
1980–1988 mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: Flöte (Werner Tripp) - Diplom mit Auszeichnung
1980–1990 mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: Tonsatz und Komposition (Friedrich Neumann, Heinrich Gattermeyer, Erich Urbanner) - Diplom mit Auszeichnung
1988 Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (Deutschland): Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm u. a.
1988 Meisterkurs (Aurèle Nicolet) Flöte
Tätigkeiten
1986– verschiedene österreichische Musikschulen: Lehrer
1969–heute freischaffender Komponist
Mitglied in den Ensembles
1987–heute Orchester der Vereinigten Bühnen Wien: Soloflötist
1988–1992 Improvisationsgruppe Things of NowNow: Flötist (gemeinsam mit Lukas Ligeti (Schlagzeug), Friedrich Neubarth (Blockflöten), Christian Minkowitsch (Keyboard))
2002–heute Ensemble Reconsil Wien: Gründungsmitglied, Flötist, musikalischer Leiter
2006–heute Komponist von Musicalsongs und Arrangeur
Aufträge (Auswahl)
New Opera Vienna Der Narr - Oper in 2 Akten
Wiener Saxophon-Quartett mehrere Auftragswerke
NetZZeit Die Liebe zu den drei Orangen - Singspiel in zwei Akten
ZeitgeNÖssischer Herbst
saxoscope - für Altsaxophon solo
Sinfonietta Baden
hörrohr Graz
Ensemble Kontrapunkte
Aufführungen (Auswahl)
Alte Schmiede Kunstverein Wien, Steirischer Herbst, Stadtinitiative Wien, Wien Modern
1996 Richard Galler (Fagott), James Vaughn (Klavier), Universität für Musik und darstellende Kunst Graz: Ajàndèk (UA, Alexander Wagendristel)
2010 Weltausstellung/Exposition Mondiale (EXPO) Shanghai musikalische Gestaltung des österreichischen EXPO-Pavillions zusammen mit Susanne Kirchmayr
2020 Tehmine Schaeffer (Sopran), Robert Chionis (Bariton), Gebhard Heegmann (Bariton), Evert Sooster (Bass), Antanina Kalechyts (Dirigentin), Ensemble Reconsil Wien, Die Verbesserung der Welt - ein Kammeropernfestival in sieben Runden - sirene Operntheater, Wien: Ewiger Frieden (UA)
Pressestimmen
2006
"Und es scheint bei ihm durchaus Programm zu sein, aus dem Hören von neuen Tönen Glückserlebnisse zu machen. Daß ihm das Musikschreiben genauso wie das eigene Musikhören enorme Freude macht, merkt man, sobald er darüber zu sprechen beginnt. Sein Komponistenhandwerk betrachtet er erfrischend unorthodox und ohne Scheuklappen in irgendeine ästhetische Richtung."
Zeitschrift der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Daniel Ender)
10. April 1994
"Komponist Alexander Wagendristel hat sich mutig an das Märchen von Gozzi, welches Thomas Strittmatter neu getextet hat, herangemacht und seine Musik als humoristische Untermalung angelegt. Damit das Stück aber dennoch den Anspruch einer Oper verdient, hat er, schamlos, aber sehr amüsant, Anleihen bei allem, was gut und populär ist, genommen."
Täglich Alles
1994
"Er strebt in seinen Werken nach größtmöglicher Erlebbarkeit für die Hörer bei dennoch weitgehender Konstruktionsarbeit."
ÖMZ - Österreichische Musikzeitschrift
Literatur
1994 Goertz, Harald, Österreichischer Musikrat (Hg.): WAGENDRISTEL Alexander. In: Österreichische Komponisten unserer Zeit (= Beiträge der Österreichischen Gesellschaft für Musik. Band 9). Bärenreiter: Kassel u. a., S. 159–160.
1997 Günther, Bernhard (Hg.): WAGENDRISTEL Alexander. In: Lexikon zeitgenössischer Musik aus Österreich: Komponisten und Komponistinnen des 20. Jahrhunderts. Wien: Music Information Center Austria, S. 1111–1114.
2010 Heinz Rögl: Porträt: Alexander Wagendristel. In mica-Musikmagazin.
mica-Artikel: Konzert des ensemble reconsil im Schönberg Center (Nachbericht) (2010),
Wikipedia-Personensuche: https://persondata.toolforge.org/p/Alexander_Wagendristel
Empfohlene Zitierweise
mica (Aktualisierungsdatum: 17. 4. 2025): Biografie Alexander Wagendristel. In: Musikdatenbank von mica – music austria. Online abrufbar unter: https://db.musicaustria.at/node/71864 (Abrufdatum: 26. 2. 2026).